„Darf ich mich zu dir setzen?“, fragt mich eine mir unbekannte, ältere Dame. Ich habe mich erst wenige Sekunden zuvor auf dieser Spielplatzbank niedergelassen. Es ist nicht die einzige Bank und auch nicht die einzige im Schatten. Außerdem habe ich gerade eine kleine Fahrradtour mit den Kindern hinter mir und eigentlich keine Lust auf Gesellschaft. Vielmehr habe ich mich darauf gefreut, einige Momente lang nichts reden zu müssen und die Seele baumeln lassen zu können.
„Ich setze mich auch ganz an den Rand, ok?“ Offensichtlich hat sie mein Zögern bemerkt. „Und krank bin ich auch nicht.“
„Ja, ist schon in Ordnung“, erwidere ich und wende meinen Blick demonstrativ meinen Kindern zu, die direkt vor mir mit Sand und Wasser aus der Pumpe herummatschen. Innerlich wappne ich mich bereits. Ich weiß, dass ich um ein wenig Konversation nicht herumkommen werde.
In den vergangenen Monaten habe ich immer wieder erlebt, dass gerade die älteren Menschen, Risikogruppe hin oder her, besonders auf Ansprache und soziale Kontakte angewiesen sind und viel daraus ziehen. Einige haben mir sogar gesagt, dass sie lieber an Corona sterben als an Einsamkeit.
Diese Aussagen und das offenkundige Bedürfnis nach ein wenig menschlicher Nähe lassen mich nicht ungerührt und so habe ich mir die Zeit sogar gerne genommen. Aber an diesem Tag bin ich völlig durch. Zudem hat diese weißhaarige Lady etwas – gar nicht mal so subtil – Penetrantes an sich.
„Schön ruhig hier, gell?“, nimmt sie das ad dato recht einseitige Gespräch wieder auf.
Ja, bis eben schon, denke ich.
„Ja, das stimmt“, sage ich.
Ich war schon lange nicht mehr hier und hab mich eh gewundert, warum der Spielplatz derart ausgestorben ist.
(Ungefähr fünfzehn Minuten später wunderte mich dann allerdings gar nichts mehr … )
„Es ist sogar so ruhig, dass ich bei mir daheim nicht einmal mehr die Fenster und Türen schließe“, spricht sie weiter. „Wenn mich einer mitnehmen will, dann soll er nur.“ Sie lacht krächzend.
„Wohnen Sie in dieser Siedlung?“, hake ich ein wenig alarmiert nach. Irgendetwas an ihrem Tonfall hat mich aufhorchen lassen. „Allein?“
„Ja, gleich da drüben.“ Sie macht eine vage Handbewegung hinter sich. „Und ich bin schon ewig allein. Mein Mann ist tot.“
„Das ist bitter“, erwidere ich.
„Mhhh“. Sie nickt. „Aber ich bin ja an der Uni und da werde ich gebraucht.“
„Ok …“ Ich runzle die Stirn und kapiere nada. Aber ich befürchte, dass entsprechende Nachfragen sie erst recht anstacheln werden.
„Bist du auch an der Uni?“, erkundigt sie sich.
„Schon lange nicht mehr.“
„Sind das deine Kinder?“ Sie deutet auf das Eiliensche und das Ämmale.
„Ja.“
„Wie alt sind sie?“
„Fünf und sieben“, antworte ich geduldig.
„Sind die beiden an der Uni?“
„Nein, sie sind im Kindergarten und in der Schule.“
„Der Bub auch?“
„Welcher Bub?“ Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, dass sie mich mit jedem zweiten Satz aus dem Konzept bringt.
„Na, der da!“ Sie deutet auf das Ämmale.
„Das ist meine jüngere Tochter.“
„Ach so.“
Inzwischen hat sich noch ein weiteres Kind zu meinen beiden geselllt.
„Gehört das auch dir?“, fragt mich meine Banknachbarin prompt.
„Nein, das wird ein Mädchen aus der Siedlung sein.“ Die Kleine lächelt mir zu. Ich lächle zurück. Aber ist da eventuell ein Funken Mitleid in ihrem Blick? Mitleid mit der weißhaarigen Lady? Oder Mitleid mit mir? Es scheint so, als würde sie die alte Frau kennen.
„Na schau, da hast jetzt noch eins gratis oben drauf“, kichert die Oma nun.
„Ich bin mit zweien schon ganz gut ausgelastet“, erkläre ich.
„Wie alt bist du?“, fragt sie mich nun unverblümt.
„Noch 43.“
„Echt? Ich hätte dich auf Anfang Dreißig geschätzt. Und so schöne schwarze Haare hast du. Ich wollte auch immer schwarze Haare. Nicht dieses dumme Blond.“
Sie klingt nicht so, als ob sie wirklich bedauern würde, dass sie einst blond war. Trotzdem sage ich:
„Jede Haarfarbe hat ihren Charme.“
Sie lächelt zufrieden.
„Wie viele Kinder hast du?“, fragt sie plötzlich.
„Na, die beiden dort.“ Ich weise erneut in Richtung Ämmale und Eiliensche. Wirklich überrascht bin ich nicht, dass sie Anzeichen von Demenz zeigt. Aber trotzdem wirkt der Umstand, dass sie mutterseelenallein lebt, nun noch verstörender auf mich.
„Und keines mehr daheim?“, hakt sie nach.
„Nur meinen Mann“, schmunzle ich. Aber ich glaube, der kleine Witz ist nicht bis zu ihr durchgedrungen.
„Ach, das ist schön. Dass du noch einen Mann hast.“ Sie seufzt. „Und, mögt ihr euch?“
„Ja, sehr. Sonst wären wir nicht verheiratet, schätze ich.“
„Sind das deine Kinder?“ Wieder zeigt sie auf meine Mädels, die nun auch schon etwas irritiert dreinblicken.
„Ja.“ Es macht wohl keinen Sinn, sie darauf hinzuweisen, dass sie mir diese Frage in den vergangenen Minuten schon mehrfach, wenn auch leicht variiert, gestellt hat.
„Wann bist du geboren?“
Nun bin ich es, die seufzt. Aber es erscheint mir zu unhöflich, nicht zu antworten.
„1976.“
„Ich weiß gar nicht, wann ich geboren bin. 1930 vielleicht. Kann das sein?“
„Ja, möglich ist es schon. Aber dann wären Sie 90.“ Ich mustere sie. Meine Beunruhigung wächst von Minute zu Minute. Ist es wirklich rechtens, dass sie allein lebt? Und habe ich das Recht, mich da einzumischen?
Abgrenzung ahoi. Dabei habe ich echt genug eigene Probleme.
„Nein, um Gottes Willen! So alt bin ich auf keinen Fall.“ Sie streicht sich mit einer beinahe eleganten Geste eine weiße Haarsträhne aus der Stirn.
Da sehe ich, dass etwas über ihren Kopf krabbelt.
„Darf ich? Sie haben da eine kleine Spinne im Haar.“ Ich pflücke ihr das Tierchen aus dem Schopf.
„Ach, glaubst du, die tut mir noch was?“ Sie lacht, aber es klingt traurig.
„Ist dein Mann auch schon tot?“, schiebt sie hinterher.
„Nein, zum Glück ist er gesund und munter.“
Ich überlege, ob ich jemanden fragen soll, ob er die alte Lady kennt. Aber wen? Hier ist keiner außer uns.
„Hast du Kinder?“
Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft sie mir die Frage mittlerweile gestellt hat.
„Ja.“
„Ich habe auch ein paar Kinder.“ Sie strafft die Schultern. „Aber meine Tochter, die ist kein guter Mensch. Und eine totale Egoistin. Und sie hat als Kind schon total komisch ausgeschaut.“
Ich fühle mich befremdet. Wer redet so über sein eigenes Kind?
„Am liebsten würde ich sie erschlagen“, fügt sie noch hinzu und ich zucke zusammen.
Auch wenn sie nicht weiß, was sie da eigentlich daherredet, hat sie meine Sympathie soeben verloren.
Und ich nehme sukzessive Abstand von dem Gedanken, jemanden zu informieren.
Ja, auch ich bin wohl kein guter Mensch. Aber ich bin schlaflos und todmüde. Ich kann gerade nicht mehr. Und soll ich wirklich für jemanden, der so abfällig über sein Kind spricht, einmal mehr über meine eigenen Grenzen gehen?
„Weißt du, wie das im Krieg war?“, greift sie nun ein anderes Thema auf. „Wir hatten nichts mehr. Aber meine Mutter meinte, das hätte auch sein Gutes. Da mussten wir wenigstens nicht so viel schleppen.“
„Da haben Sie bestimmt viel mitgemacht“, antworte ich und überlege fieberhaft, wie ich mich am besten aus der Affäre ziehe. Gleichzeitig schreit mich mein Gewissen an, dass ich doch nicht einfach abhauen kann.
„Sind das deine?“ Wieder deutet sie auf meine Töchter.
„Ja.“
„Zwei Mädchen. Das ist gut. Die können miteinander spielen. Ich habe einen Bub und eine Tochter. Die haben nicht miteinander gespielt. Aber meine Tochter ist eh ein Miststück. Sie besucht mich nicht einmal.“
„Das ist nicht schön“, gebe ich mich diplomatisch.
„Ich gehe nur einmal in der Woche etwas essen. Deshalb habe ich auch meine gute Figur behalten.“
„Hm.“ Mir fällt nichts mehr ein.
Stattdessen informiere ich meine Kinder darüber, dass wir in fünf Minuten aufbrechen.
„Ich wünsche Ihnen alles Gute!“, verabschiede ich mich von der Frau.
„Dir auch! Und ruf mich mal an!“, antwortet sie. Und weckt damit erneut mein Mitgefühl.
Ich überquere den Spielplatz, auf dem sich inzwischen auch eine andere Familie tummelt, die offensichtlich aus der Siedlung stammt.
Ich postiere mich bei den Fahrrädern und verstaue unsere Sachen in der Seitentasche. Aus den Augenwinkeln beobachte ich, wie die alte Frau nun zielgerichtet besagte Familie ansteuert.
Diese hatte sich eben noch auf Deutsch unterhalten, switcht aber nun um zu Englisch.
Offenbar kennen sie die Lady. Diese lässt sich von eventuellen Sprachbarrieren nicht abschrecken und spricht die Mutter an. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie sich nicht zum ersten Mal Kontakt haben und die abwehrende Körperhaltung der jüngeren Frau spricht Bände.
Ganz wohl ist mir nicht dabei, dass ich mich mit meinen Kindern aus dem Staub mache. Aber ich stopfe meinem schlechten Gewissen mit der Ausrede, dass ich nicht einmal aus diesem Ort bin und die alte Lady wohl den Anwohnern hier durchaus präsent ist, das Maul.
Ein paar Tage später wurde diese meine Vermutung von einer Freundin bestätigt. Die Oma ist dort wohl bekannt wie ein bunter Hund.

Ich hab zwar (noch) kein Alzheimer, aber trotzdem werde auch ich immer vegesslicher.
Als ich heute in der Radiologie gefragt werde, wann meine letzte Mammographie war, weiß ich es nicht mehr und an einen Überweisungsungsschein habe ich auch nicht gedacht. Wenigtens den Termin habe ich nicht versäumt – dem Handykalender sei Dank.
Aufgrund meines dichten Brustgewebes und diverser Fibroadenome, die sich heute allerdings als ordinäre Zysten entpuppten, werde ich halbjährlich zur Kontrolle einbestellt. Mal nur Ultraschall, mal Ultraschall plus Mammographie. Aufgrund von Corona ist ein Termin ausgefallen. Ich war also über ein Jahr nicht mehr zur Kontrolle und mir ist tatsächlich entfallen, wann die Brust zuletzt geröntgt wurde.
Als ich im Wartebereich das tue, was man in einem Wartebereich eben so tut, kommt irgendwann eine ältere Dame – ja zur Zeit ziehe ich betagte Ladys scheinbar magisch an – aus einem der Sprechzimmer. Sie setzt sich, wie sollte es auch anders sein, direkt auf den Stuhl neben mir. Und der ist natürlich keine 1,5m entfernt, obwohl überall in der Praxis mittels entsprechender Aushänge eindringlich auf das Abstandsgebot hingewiesen wird.
Gut, es gibt noch viel mehr Stühle. Wahrscheinlich geht das, im Übrigen sehr freundliche, Personal davon aus, dass die Patienten von sich aus einen Stuhl zwischen sich und Nebenmann auslassen.
Die Frau bemerkt meinen skeptischen Blick.
„Sitze ich zu nah?“, fragt sie mich prompt.
„Na, anderthalb Meter sind das nicht“, erwidere ich mit einem, meine harsche Bemerkung hoffentlich abmildernden, Lächeln. „Aber wissen Sie was? Ich rutsche einfach noch ein Stück nach links.“
Gesagt, getan.
„Sind Sie auch beim Herrn Dr. X?“, fragt sie mich.
„Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, bei wem ich bin“, antworte ich wahrheitsgemäß. „Die vergangenen Male war ich immer in der Schwesterpraxis im Nachbarort.“ (Das Radiologiezentrum verfügt über drei Praxen.)
„Der Dr. X. hat mir gerade die Hand gegeben“, spricht sie nun weiter. „Wahrscheinlich hat er es einfach vergessen, dass man das nicht soll. Er ist schließlich auch schon Mitte Siebzig.“
Das kann ja heiter werden, denke ich.
Als ich nach der Mammographie, die von einer Arzthelferin vorgenommen wurde, barbusig im Sprechzimmer auf der Liege hocke, stelle ich mich mental bereits darauf ein, dass gleich ein Tattergreis in gebückter Haltung zur Tür hereinschlurft.
Stattdessen steht mir Augenblicke später ein Mann gegenüber, von dessen Spannkraft ich mir selbst noch eine dicke Scheibe abschneiden könnte. Die wachen, hellen Augen oberhalb der Maske blitzen. Außerdem – und ich weiß, das klingt jetzt sehr klischeehaft – strahlt seine ganze Haltung so viel Kompetenz und Erfahrung aus, dass ich mich auf Anhieb geborgen fühle. (Ich glaube, in dieser Hinsicht habe ich echt einen Knacks.)
Da ich meine Hände vorsorglich hinter mir und damit außerhalb seiner Reichweite platziert habe, fasst er mich zur Begrüßung an der Schulter. Aber Corona mal außen vor, werden bei einer Brustuntersuchung sowieso zwangsläufig noch viel intimere Stellen berührt als nur eine Schulter.
Im Grunde ist diese ganze aufgezwungene Distanz ohnehin wahnsinnig unnatürlich, wie auch meine „Vorgängerin“ im Wartebereich konstatierte. Und ich bin sogar dankbar dafür, wenn sich der ein oder andere – sofern es in Sachen Zwischenmenschlichkeit und Vertrauensfindung angebracht ist – darüber hinwegsetzt.
Dass mir selbst das Abstandhalten allerdings inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen ist, merke ich aber u.a. daran, dass ich sogar auf der Liege versuche, ordentlich Luft zwischen uns zu lassen. Aber so geht das natürlich nicht.
„Rutschen Sie noch ein bisschen näher zu mir“, fordert mich der Arzt auf. „Noch näher. Und noch ein Stück. Ich beiße nicht.“
Da muss ich dann doch lachen. „Das glaube ich Ihnen. Sie machen wirklich einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck.“
„Das freut mich.“
Grotesk ist das aber alles schon.
Und das Bild dazu: Oben ohne, aber mit Mundschutz.
Sei`s drum. Mein Ersteindruck wird während der Untersuchung mehrfach bestätigt. Man kann sagen, was man will: So viele Jahrzehnte Erfahrung machen sich halt doch bemerkbar.
Er äußert sich sehr lobend über die Kollegin, die mich das letzte Mal untersucht hatte und schafft es, sie in dem ein oder anderen Punkt geringfügig zu korrigieren, ohne sie dabei in einem schlechten Licht dastehen zu lassen.
Dass es sich bei den von ihr festgestellten Fibroadenomen um mit Flüssigkeit gefüllte Zysten handelt, die mir auch hin und wieder Schmerzen bereiten, macht unterm Strich auch keinen großen Unterschied. Dass er aber klipp und klar sagt, dass er in meinem Fall kein erhöhtes Brustkrebsrisiko sieht, schon.
Ich muss zugeben, ich hänge nicht nur an meinem Leben, sondern auch an meinen Brüsten.

Zum Gitarrenfoto, welches im Rahmen einer FB-Challenge entstanden ist: Mal abgesehen davon, dass auf dem Foto meine Nase glänzt und ich am Rocksaum scheinbar einen mysteriösen Fleck habe, der live und mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist, arbeite ich gerade an der Instrumentalversion von „Moon River“. Ich habe da ein sehr schönes klassisches Arrangement gefunden.
Auf Instagram, wo ich in der Story meine ersten Übungsversuche veröffentlichte, wurde ich gebeten, beizeiten auch die Audrey-Hepburn-Version mit Gesang zu performen, und ohne lange nachzudenken, sagte ich zu.
Aber ich klinge irgendwie schrecklich bei dem Lied und die Gitarrenbegleitung gefällt mir beim Original auch nicht so 100 pro. Sie ist irgendwie zu „dünn“, dabei aber gar nicht mal so easy und ganz anders als das von mir präferierte Klassikarrangement.
Naja, mal sehen.

In Sachen Zuckerfreiheit läuft es weiterhin gut. Auch wenn manches Küchenexperiment, wie z.B. diese zuckerfreien Gummibärchen, in die Hose geht. Optisch top, geschmacklich Flop. Ausgerechnet meinem Mann allerdings munden die Bärchen. Dabei mag er eigentlich gar keine Gummibärchen.
Der zuckerfreie Hefeteig dagegen ist wirklich eine Wucht. Er gelingt ein jedes Mal und schmeckt, gleich in welcher Variante, immer wunderbar.








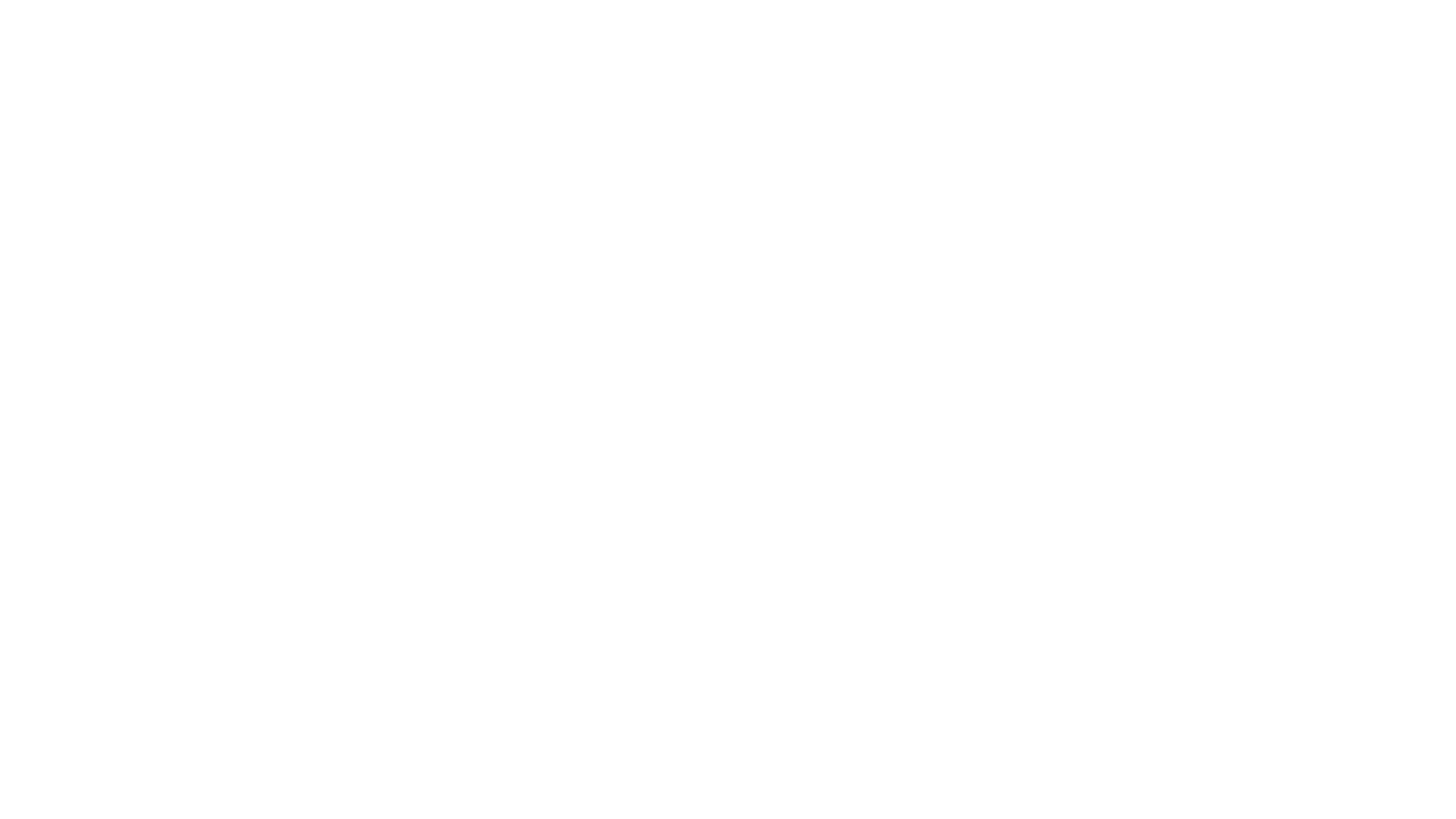
Neueste Kommentare