Dieses Kapitel fällt zwar etwas kürzer aus als gewohnt. Dafür hält es eine erste Auflösung bereit. 🙂
Fenster in die Vergangenheit
Gleißendes Sonnenlicht empfängt sie, als sie aus dem Schatten der Bäume auf die Lichtung tritt. Die bunte Blumenpracht ist üppiger denn je und nur ein paar Meter von ihr entfernt grasen zwei Bergziegen. Dieser Hang ist Priska wohlvertraut. Und auch wieder nicht. Noch vermag sie es nicht zu greifen, doch etwas ist verkehrt. Als befinde sich die gewohnte Welt nicht ganz an ihrem Platz. Der Schlüssel passt ins Schloss, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Ein merkwürdiges Gefühl beschleicht Priska. Hektisch lässt sie ihren Blick umherschweifen, auf der Suche nach dem alten Haus. Noch bevor es in ihr Sichtfeld rückt, beginnt ihr Puls zu rasen. Was, um alles in der Welt, hat sie hier verloren? An diesem gottverlassenen Ort, der sie vor gar nicht langer Zeit in Todesangst versetzt hat. Das von Hass verzerrte Gesicht, das über dem Kragen der hochgeschlossenen Bluse thronte, hat sich unauslöschlich in ihrer Seele eingebrannt. Es spielt keine Rolle, dass sie jenes Erlebnis nur geträumt hat.
Schläft sie etwa auch jetzt, in diesem Augenblick?
Priska macht noch eine Handvoll Schritte in die Lichtung hinein und die beiden hohen Fichten geben den Blick frei auf die Holzhütte, die sich wie eh und je an die schroffe Felswand schmiegt. Priska braucht einen Moment, bis sie erkennt, was sie an diesem idyllischen Bild stört. Dann sieht sie es. Die Scheiben sind allesamt intakt. Und die Fensterläden, die schon immer windschief in den Angeln hingen, sind frisch gestrichen und an beiden Seiten ordentlich in den eisernen Haken verankert. Priska lässt ihren Blick weiterwandern. Erstaunt stellt sie fest, dass die komplette Holzfassade renoviert wurde. Keine Spur mehr von den wurmstichigen, vermoderten Latten. Und auch die klaffenden Löcher, durch die stets der Wind blies und mit seinem unheimlichen Geheul Eindringlingen kalte Schauer über den Rücken jagte, sind verschwunden. Vor der Hütte steht eine Bank. Jemand hat eine blecherne Milchkanne auf ihr abgestellt. Und neben der ebenfalls generalüberholten Tür hängt eine Laterne. Das alte Haus wird seinem Namen nicht mehr gerecht. Es sieht schmuck und bewohnt aus. Priskas Finger zittern, als sie sich die Nase zuhält und den Mund verschließt. Sie hat Andreas davon erzählt, dass sie nach einer Möglichkeit sucht, um Traum und Wirklichkeit voneinander zu unterscheiden und er zeigte ihr eine Handvoll von Realitätstests, die ihr dabei helfen würden. Falls sie trotz verschlossener Nase und Lippen fähig ist, zu atmen, dann träumt sie. Fast rechnet sie damit, dass sie es kann, denn wie sonst ließe sie sich dieses surreale Szenario erklären?
Doch tatsächlich bekommt sie keine Luft. Überrascht löst sie die Finger von ihrer Nase und atmet tief ein. Sogleich versucht sie, sich selbst zu beruhigen. Dass der Realitätscheck positiv ausgefallen ist, heißt schließlich gar nichts. Hätte sie trotzdem atmen können, wäre das ein sicherer Beweis dafür gewesen, dass sie sich in einem Traum befindet. Doch umgekehrt gilt das nicht. So hat es ihr zumindest Andreas erklärt. Manchmal werden die realistischen Gegebenheiten durchaus in die Traumwelten übernommen. Obwohl Priska bereits weiß, dass auch dieser Trick nicht funktionieren wird, breitet sie die Arme aus. Normalerweise ist das Fliegen im Traum eine ihrer leichtesten Übungen. Doch diesmal vermag sie es nicht, sich in die Lüfte zu schwingen und über die Schwerkraft hinwegzusetzen. Falls sie nicht träumt, dann muss sie an Amnesie leiden. Sie hat nach wie vor keine Ahnung, wie sie hierher gelangt ist. Ihre fehlende Erinnerung stört sie fast noch mehr als das in neuem Glanz erstrahlende, alte Haus. Priska blickt an sich hinunter und nun ist sie erst recht verwirrt. Sie trägt ihr Nachthemd. Doch die Füße stecken in ihren Sneakers. In solch einer seltsamen Aufmachung würde sie niemals vor die Tür gehen.
»Ich kapier gar nichts mehr«, murmelt sie. In diesem Moment hört sie ein Kind lachen und kurz darauf taucht eine kleine Gestalt am unteren Ende der Sommerwiese auf. Es ist ein Mädchen. Das lange Haar tanzt im Wind. Die Schürzenzipfel seines Kittelkleidchens hat es zu einem Beutel zusammengerafft. Leichtfüßig erklimmt die Kleine die Steigung. Sie erscheint Priska seltsam vertraut. Doch das kleine Antlitz ist nur ein heller Fleck. Die Sonne blendet Priska zu sehr. Mit einer Hand schirmt sie ihre Augen ab und langsam formen sich die Gesichtszüge aus.
»Eleonore!«, ruft Priska. Zweifellos ist es das Geisterkind, das da direkt auf sie zugerannt kommt. Doch offensichtlich handelt es sich nicht um eine bloße Manifestation. Eleonore wirkt völlig verändert. Ihre Haut ist rosig. Wangen und Stirn sind von der Sonne geküsst. Und in den dunklen Augen liegt ein warmes Leuchten. Die Lippen sind verschmiert und ein paar blutrote Spritzer haben sich auf Eleonores Kinn verirrt. Kurz muss Priska an einen Vampir denken und sie fröstelt. Doch an derlei Wesen glaubt sie nicht und von einem Blutsauger mit bronzefarbenen Teint hat sie auch noch nie gehört. Wobei sie inzwischen nichts mehr für unmöglich hält. Noch während Priska am Grübeln ist, greift Eleonore in ihre Schürze und holt eine Walderdbeere heraus. Genüsslich stopft sie sich die Frucht in den Mund. Doch von Priska scheint sie keine Notiz zu nehmen.
»Eleonore?«, wagt sie einen weiteren Vorstoß. Das Kind reagiert nicht.
»Sie kann dich nicht sehen, Priska«, ertönt in diesem Moment eine sanfte Stimme hinter ihr. Priska fährt herum. Doch da steht niemand.
»Komm zurück in den Wald«, flüstert die scheinbar körperlose Stimme eindringlich. »Sie soll nicht wissen, dass ich hier bin.« Perplex stolpert Priska auf den Waldrand zu. Ihre Augen benötigen einen Augenblick, um sich von dem hellen Sonnenlicht auf die Dämmerung umzustellen, die sie umfängt, kaum, dass sie sich erneut in den Schutz der Bäume begibt. Dann registriert sie die hochgewachsene, junge Frau, die vorsichtig hinter einem Baumstamm hervorlugt. Es ist Amalia. Beziehungsweise ihr fleischgewordenes Spiegelbild. Das Engelsgesicht ist vollkommen. Und auch mit einem Geist hat sie nichts mehr gemein. Ihre Haut ist ebenso wenig durchscheinend wie die von Eleonore. Die aristokratische Blässe allerdings ist geblieben.
»Träume ich, Amalia? Hast du mich hierher geführt?« Priska hat alle Mühe damit, all die neuen Eindrücke zu verarbeiten. Noch immer kann sie sich keinen Reim darauf machen, was hier vorgeht.
»Nein, du träumst nicht.« Amalia mustert sie nachdenklich. Offensichtlich muss sie ihre nächsten Worte genau abwägen. »Ich habe dich nur in eine Art Hypnose versetzt. Um dich mitnehmen zu können.« Wieder legt sie eine kurze Pause ein. »In die Vergangenheit. Wir befinden uns im Jahr 1874.« Priska wird zunächst heiß, dann kalt. Auch wenn ein Teil ihres Unterbewusstseins eine solche Antwort schon erwartet hat.
»Bin ich auch … physisch anwesend?«
»Ja«, erwidert Amalia knapp.
»Und warum habe ich dann nur mein Nachthemd an?« Priska zeigt anklagend auf ihr dünnes Hemd. Allerdings ist hier Sommer und es sind nicht die Temperaturen, die sie zittern lassen, sondern ihre Gedanken. »Und sollte Eleonore mich nicht sehen können, wenn ich tatsächlich hier bin?«
»Ich wollte keine Zeit vergeuden«, sagt Amalia. »Und an die Fußbekleidung habe ich schließlich gedacht«, rechtfertigt sie sich. »Eleonore kann dich nicht sehen, weil du derzeit noch Zaungast bist.« Sie seufzt und scheint kurz zu überlegen. Dann fährt sie fort: »Stell dir vor, du seist in einem 3-D-Film. Die Technik ist mittlerweile so ausgereift, dass nicht nur deine Augen, sondern auch deine übrigen Sinne die Umgebung als echt wahrnehmen. Trotzdem kannst du nicht mit den Schauspielern interagieren.«
»Was weißt du von 3-D-Filmen?«, wirft Priska konsterniert ein. Doch Amalia ignoriert ihre letzte Frage und blickt ihr fest in die Augen. »Du wirst ein wenig Übung benötigen, um vollständig in diese Dimension einzudringen. Momentan befindest du dich zwischen den Zeiten. Ein wenig vergleichbar mit Elenas und Ranieris Situation. Und nur Geschöpfe meiner Art können dich wahrnehmen.«
»Was soll das heißen? Geschöpfe deiner Art? Und wieso hast du mich hergebracht?« Priska merkt selbst, dass sie heiser klingt und ihr Hals fühlt sich an, als habe sie ein Reibeisen verschluckt.
»Ich will dir dabei helfen, Antworten zu finden«, erwidert Amalia lächelnd. Priska blickt wieder zu Eleonore, die zufrieden im Gras sitzt und eine der zutraulichen Ziegen streichelt. Das Tier hat sich wiederkäuend neben dem Mädchen niedergelassen.
»Dann ist das dort also keine verstorbene Seele, sondern die lebende Eleonore?« Krampfhaft versucht Priska, ihre Gedanken zu sortieren. Amalia nickt. »Und was ist nun mit dir? Du siehst so anders aus? Bist du die Amalia, die mir 2015 begegnet ist oder die Amalia aus dem Jahr 1874?« Priska merkt selbst, wie verrückt ihre Worte klingen. Sie massiert ihre Schläfen und überlegt, wie sie sich klarer ausdrücken kann, ohne Amalias Tod ins Spiel zu bringen. Sie hat noch gut in Erinnerung, was Andreas ihr anvertraut hat. Dass Amalia und ihre Mutter nicht wissen, dass sie nicht mehr am Leben sind.
»Ich bin beide«, antwortet Amalia gelassen. Ihre grünen Augen funkeln. Sie wirkt belustigt. »Andreas hat unrecht. Meine Mutter und ich wissen sehr wohl, dass wir 1875 ums Leben gekommen sind. Es ist nur einfach nicht von Belang. Tot sind wir trotzdem nicht. Wir sind Zeitenwandler. Ein Teil meines Ich lebt in der Vergangenheit und bewohnt dort diesen Körper. Es kann sich jederzeit mit dem Rest meines Bewusstseins verbinden, das sich frei durch die Dimensionen bewegt. Jetzt, in diesem Moment, ist mein Geist gebündelt und zu einer Einheit verschmolzen.«
»Komplizierter geht es nicht mehr, oder?« Priska stöhnt. »Versteh mich nicht falsch, Amalia. Ich bin dir unendlich dankbar dafür, dass du mich unterstützen möchtest. Aber irgendwie übersteigen diese Informationen mein Erbsenhirn. Wahrscheinlich bin ich zu simpel gestrickt für das alles.«
»Da irrst du dich gewaltig«, entgegnet Amalia. Der Schalk in ihren Augen ist verschwunden. »Und du tätest gut daran, bald zu begreifen.«
»Ich schätze, Eleonore kann das nicht? In die Vergangenheit reisen? Andernfalls wäre das Geheimnis um ihre Herkunft schließlich keines?« Sie wartet Amalias Antwort nicht ab. Ein paar Puzzlestücke scheinen sich gerade von selbst zusammenzufügen. »Und Ranieri wird es nicht anders ergehen, oder?«
»Korrekt«, bestätigt Amalia ihre Vermutungen. »Es gibt wenige Wesen wie mich. Nur, weil man wie Eleonore und Ranieri zwischen Dies- und Jenseits festhängt, hat man nicht automatisch Zugang zu den anderen Dimensionen.« Liegt da ein Hauch von Zynismus in Amalias Stimme? Eine Bewegung am Rande ihres Gesichtsfeldes lenkt Priskas Aufmerksamkeit zurück auf die Lichtung. Im selben Moment stockt ihr der Atem. Sie muss nicht eine Sekunde überlegen, wer diese dunkelhaarige Frau ist, die lachend und mit wehenden Röcken auf Eleonore zuläuft.
»Mama«, stößt Eleonore freudig aus. Sie erhebt sich und streckt die Arme ihrer Mutter entgegen. Derselben Frau, die Priskas Tod will. Ein Schwindelgefühl erfasst Priska und sie stützt ihre Hand gegen die harzige Rinde des Fichtenstamms neben sich. Mutter und Tochter fallen sich um den Hals. Beide drehen sich übermütig im Kreis und Eleonores Jauchzen lässt keinen Zweifel daran, wie glücklich sie in diesem Moment ist. Die goldenen Creolen an den Ohren der schwarzen Frau leuchten im Sonnenlicht wie kleine Flammen. Und ihr sorgsam geflochtener Haarkranz hält dem wilden Tanz nicht Stand. Schließlich setzt sie das Kind ab, um sich die losen Strähnen hinters Ohr zu klemmen und Priska bietet sich zum ersten Mal die Möglichkeit, das Profil ihrer Erzfeindin eingehender zu studieren. Die Gesichtszüge sind glatt. Noch ist nichts von der Bitterkeit und dem Hass zu erkennen, die dieses attraktive Gesicht später verunzieren werden Sie ist nicht hübsch im klassischen Sinne. Mehr eine herbe Schönheit, mit auffallend markanten Konturen. Und sie ist kein Zimmergewächs. Die Blusenärmel sind hochgekrempelt und die Unterarme sehnig. Diese Frau ist es gewohnt, hart zu arbeiten. Wie alt mag sie wohl sein? Im Jahr 1874? Priska schätzt sie auf Ende zwanzig. Nur wenige Meter von ihr entfernt knackt es plötzlich im Gehölz und Priska zuckt erschrocken zusammen. Sie erhascht einen kurzen Blick auf einen breiten Rücken und einen schwarzen Haarschopf. Dann ist der Mann verschwunden. Nur um einige Sekunden später wieder auf der Lichtung aufzutauchen.
»Papa«, quiekt Eleonore und der Fremde geht vor ihr in die Hocke und zieht das Kind in seine braungebrannten Arme.
»Was habe ich dich vemisst, meine Eleonore!« Seine Stimme ist tief und verfügt über ein melodisches Timbre, das Priska ohne Umwege direkt ins Herz dringt. Es scheint unmöglich, doch irgendwoher kennt diesen Mann. Verwirrt sieht sie zu Amalia hinüber, aber die hebt nur einen Finger an die Lippen. Über das Gesicht der Frau wandert ein verliebtes Strahlen und sie streicht ihrem Gemahl zärtlich über die schwarzen Locken. Seltsamerweise reagiert er nicht auf ihre Berührung, sondern bleibt allein seiner Tochter zugewandt. Es dauert nicht lange und die Verzückung im Gesicht der Frau weicht Traurigkeit. Ihr leises Seufzen weht bis zu Priska hinüber, die inzwischen wieder ein wenig nach vorne getreten ist. Wieso soll sie sich verstecken, wenn ohnehin niemand sie wahrnehmen kann? Grübelnd betrachtet sie den Hinterkopf des Mannes und registriert beiläufig, dass die Frauenhand mit dem Streicheln aufgehört hat und nun reglos auf dem Haupt ihres Gatten ruht. Priskas Blick wandert nach oben. Und trifft direkt auf zwei schwarze Augen, aus denen ihr jetzt blanker Hass entgegenspringt. Der Schock durchfährt Priska wie ein Blitz und kurz darauf ergreift die grauenvolle Kälte von ihr Besitz.
»Wie kann das sein?«, ruft Amalia erstickt. »Sie ist keine von uns. Wieso kann sie dich sehen?« Fast panisch greift sie nach Priskas Hand. »Schnell, wir müssen fort von hier. Dieser Ort ist nicht mehr sicher!«
»War er das jemals?«, erwidert Priska ruhig, obwohl in ihrem Inneren ein Orkan tobt. Sie steht da wie angewurzelt. Ihre Beine fühlen sich an wie Blei. Amalia zerrt an ihr. Da beginnt die Frau zu lachen, doch es klingt alles andere als heiter. Sowohl Eleonore als auch der Mann drehen sich um und folgen ihrem Blick. Priska schnappt überrascht nach Luft und für einen Augenblick vergisst sie sogar die tödliche Gefahr, in der sie sich befindet. Er sieht anders aus. Weder die Statur, das Haar, noch sein Gesicht weisen auch nur die geringste Ähnlichkeit mit ihm auf. Und doch ist er es. Mit gerunzelter Stirn blickt Ranieri angestrengt in ihre Richtung, ohne sie zu sehen. Ein Hauch von Karersee liegt in seinen hellbraunen Augen.







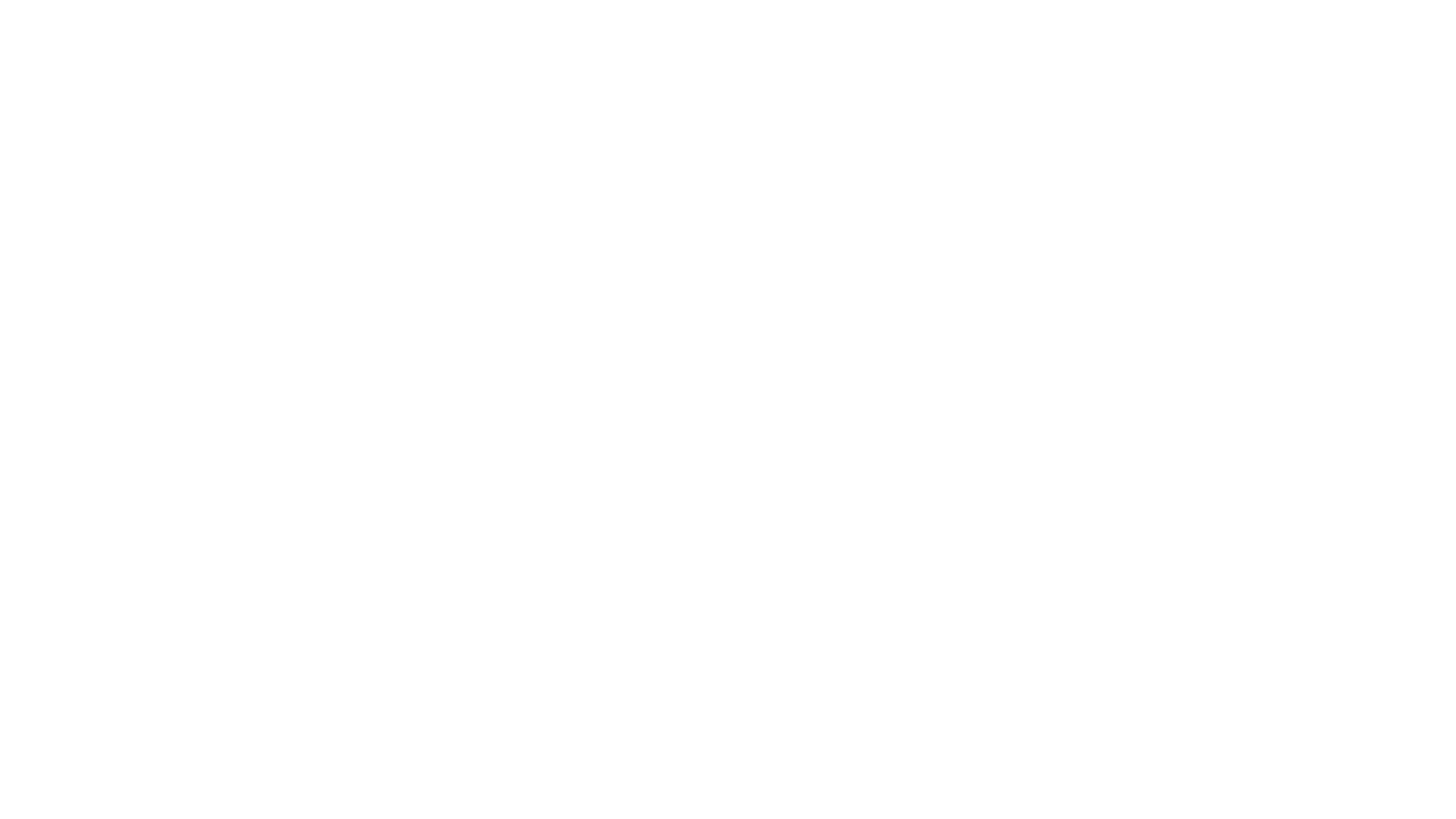
Kommentar verfassen