Des Menschen Gemüt ist leider so konstruiert, dass ein Zustand immerwährender Zufriedenheit kaum zu erreichen ist.
Vor einem Dreivierteljahr war noch jede Mahlzeit, die wir ohne Babygeschreiuntermalung einnehmen konnten, wie Weihnachten. Heute wünsche ich mir, einmal in Ruhe essen zu können, ohne dass mir das Eiliensche Löcher in den Bauch fragt, kategorisch zu allem „Iiiiih“ sagt, was auf ihrem Teller liegt und ich mit dem Ämmale nicht nach jedem einzelnen Happen einen anstrengenden Ringkampf um den Breilöffel ausfechten, sie dabei mit diversen Spielsachen bespaßen und später die Kollateralschäden von Wänden, Möbeln und Böden schrubben muss.
Damals war ich unendlich dankbar dafür, dass ich nach jener unsäglichen Odyssee von Krankheiten und Fieberschüben wider Erwarten doch nicht abgekratzt bin. Aktuell machen mich schon solche Lappalien wie das ständige Bakterien- und Virenpingpong mürbe.
Warum ist das so?
Warum schraubt sich die Erwartungshaltung nach einem durchlebten Tief binnen kürzester Zeit wieder derart nach oben, dass man unmittelbar Gefahr läuft, gleich in das nächste Loch zu plumpsen?
Warum?
Obwohl ich mir ständig selbst die Leviten lese, komme ich nicht an, gegen diesen Alltagsblues, der mich doch erschreckend oft am Schlafittchen packt.
Beruhigend finde ich, dass es anderen Müttern ähnlich geht. Die Posts zum Thema „Fremdbestimmung“ sind beinahe austauschbar, trotz der individuellen Persönlichkeiten und Geschichten, die dahinterstecken.
Als ich noch keine Kinder hatte, konnte ich diese Gefühle nicht einmal ansatzweise nachvollziehen. Ich verstand nicht, warum Kleinkindmütter beklagten, zu wenig Zeit für sich zu haben, wo sie doch nicht einmal berufstätig waren, während ich 60-Stunden-Wochen schob. Und über diejenigen, die ihr Kind bereits mit einem Jahr in der Kita parkten, um sich wieder in den Job zu stürzen, obwohl sie es finanziell absolut nicht nötig hatten, habe ich erst recht den Kopf geschüttelt.
Tja, und nun? Inzwischen bin ich selbst zu so einer dieser Mamas mutiert, die ich früher insgeheim so rigoros verurteilt habe.
Das habe ich mittlerweile akzeptiert. Dennoch schäme ich mich.
Für manche Eltern wäre inbrünstiges Babygeschrei Musik in den Ohren, einfach, weil es hieße, dass ihr Kind am Leben ist. Andere wiederum würden liebend gerne den ganzen Tag hinter ihrem Sprössling hinterherhechten, anstatt ihn im Rollstuhl spazieren zu fahren.
Ich danke Gott tatsächlich an jedem neuen Tag dafür, dass meine Kinder gesund sind und sie hoffentlich auf ihren eigenen Beinen und angetrieben von ihren eigenen Wünschen und Ideen durch dieses Leben werden gehen können.
Trotzdem kann ich es einfach nicht verhindern, dass ich mich offen gestanden häufig nach einer kleinen, ausschließlich mir vorbehaltenden Auszeitinsel im turbulenten Familienalltag sehne. Und dass ich angesichts der unzähligen Bedürfnisse, die ständig an mich herangetragen werden, häufig Stimmungsschwankungen unterliege, welche ich in dieser Bandbreite und Intensität höchstens aus meiner eigenen Pubertät kenne.
Auch wenn es nicht so aussehen mag, ist jede Minute, die ich in diesen Blog und in meinen Roman stecke, hart erkämpft. Meistens zwacke ich die Zeit von den paar Stunden ab, die ich eigentlich zum Schlafen nutzen sollte. Effizient geht aber anders. An 9 von 10 Abenden liege ich bereits völlig erschossen auf der Couch, zwei Minuten, nachdem wir die Kinder ins Bett gebracht haben. Um mich vom Zombiestatus in einen zum Denken und Schreiben fähigen Homo sapiens zurück zu verwandeln, gehen geschätzt 98 Prozent meines verbleibenden, ohnehin schon mickrigen Energievorrates drauf. Die übrigen 2 Prozent sind aber tatsächlich in der Lage, sich mit beinahe exponentieller Geschwindigkeit zu vermehren, sobald ich in den Schreibfluß gesprungen bin. Dummerweise habe ich mich aber meist gerade dann warmgeschwommen, wenn die Uhr mahnend darauf hinweist, dass in spätestens 3 Stunden das Ämmale und das Eiliensche die Nacht für beendet erklären.
Und so kann es durchaus passieren, dass nicht die Stirn des Babys, sondern die der Mutter eine Beule ziert, weil sie – die Mutter, nicht die Beule – im Zustand völliger Übermüdung und geistiger Umnachtung gegen die vom Mann strategisch äusserst günstig auf Augenhöhe platzierten Pfannenwender gestolpert ist.
Bereits während ich diese Zeilen tippe, türmt sich das schlechte Gewissen schon wieder meterhoch vor mir auf und ich überlege ernsthaft, diesen Post einfach im Nirwana verschwinden zu lassen.
Die Liebe zu meinen Kindern ist unendlich groß, die Zeit mit ihnen kostbar.
Ich sollte diese Minuten, Stunden, Tage, Monate und Jahre, die im Grunde schneller als Sand durch die Finger rieseln, nicht vergeuden.
Irgendwann werde ich meine Wege in diesem Haus wieder alleine zurücklegen – ohne dass ein Baby brabbelnd und glucksend hinter mir her tappt und ohne dass ein kleines Mädchen im Nebenraum glockenhell lacht und sich im Kreise drehend Kinderlieder singt. Und dann werde ich mit Sicherheit nicht glücklicher sein, als jetzt, in diesem Moment.
Ich teile mein Heim mit Zauberwesen. Großherzige Feen und wütende Kobolde in Personalunion. Sie spenden unendlich viel Liebe und Kraft und sind ein nie versiegender Quell der Inspiration und des Lebens. Doch es gibt Momente, in denen sie einem alles abverlangen und einen weit über die eigenen Grenzen hinaus treiben.
Ein greifbares Problem in meinem Alltag ist der Mangel an Struktur. Gerade Kinder lieben aber feste Rhythmen und Rituale. Sie geben ihnen offenbar Halt in einer Welt, die sie mit neuen Erfahrungen quasi sekündlich bombardiert. Leider bin ich alles andere als gut durchorganisiert. Ich merke aber deutlich, dass mich der Anforderungsberg nicht ganz so tief unter sich begräbt, wenn ich mich mit einer Art Plan im Gepäck daran mache, ihn zu erklimmen, auch wenn ich Sisyphos dabei gelegentlich den Rang ablaufe.
Und es hilft, meine Kinder in den jeweiligen Plan einzuweihen. Es fällt ihnen leichter, die Belagerung meiner Person zumindest kurzfristig zu unterbrechen, wenn sie wissen, dass wir ein Buch anschauen, malen, tanzen oder Seifenblasen machen, sobald ich dies und jenes erledigt habe. Zu Rollenspielen muss ich mich bekanntermaßen nach wie vor überwinden, aber fünfzehn Minuten gemeinsames Dornröschen-fängt-Malefiz-und-sperrt-sie-in-die-Katzenbox-alias-Gefängnis-Spielen können durchaus in eine Dreiviertelstunde Ruhe münden, sollte das Kind tief genug in die Phantasiewelt abgetaucht sein. Dabei zuzusehen, wie das Eiliensche die Figuren in eigene Geschichten verstrickt und das Ämmale daneben gurrend ebenfalls die Puppen tanzen läßt, indem sie hingebungsvoll das Spiel ihrer großen Schwester imitiert, kommt purer Wonne gleich.
Zum Schreiben reichen diese kurzen Pausen natürlich nicht, aber ein kleiner Beruhigungskaffee 😉 ist hin und wieder durchaus drin.
Und wenn ich ehrlich bin, habe ich in den letzten Jahren vor den Kindern doch noch viel weniger geschrieben. Nämlich nichts. Damals hat mir die Inspiration gefehlt. Jetzt ist Inspiration vorhanden – in Hülle und Fülle, aber es mangelt an Zeit, sie umzusetzen.
Weiterhin hätte ich auch ohne diese Zusatzambitionen das Gefühl, nie zu genügen und nichts auf die Reihe zu bringen. Es ist mir ein Rätsel, wie andere Familien das ganze Drumherum so locker gewuppt bekommen, während es hier immer aussieht, als hätte in jedes Zimmer mindestens eine Bombe eingeschlagen. Sich selbst ständig die eigene Unzulänglichkeit vor Augen zu führen, trägt sicherlich ein nicht unerhebliches Quäntchen bei zum sogenannten Alltagsblues, der jedoch nie die fröhlichen und lebenshungrigen Stimmen meiner Töchter übertönen wird.
Abschließen möchte ich diesen reichlich verworrenen Post mit folgendem Dialog, den ich vorhin schon via Twitter in die Welt entlassen habe:
Eiliensche: „Was spielen wir jetzt?“
M.: „Ich will schlafen spielen. Wer am längsten schläft, hat gewonnen. Die Mama verliert.“







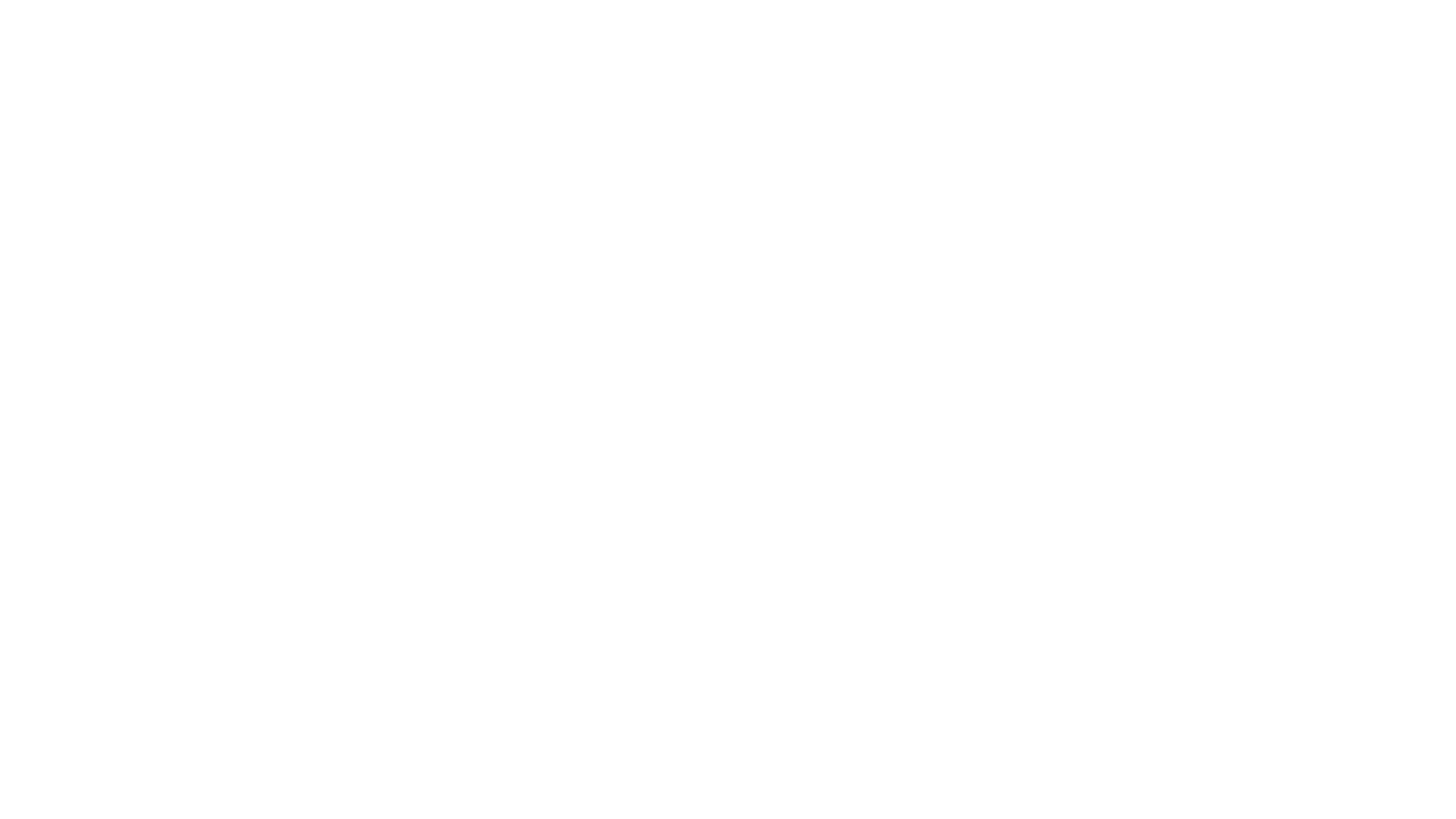
Wenn ich mal wieder platt bin, fällt mir oft eine Geschichte eines Freundes ein, die er mir letztes Jahr erzählt hat. Er hat 2 Kinder, beide schon in der Schule:
„Nachdem das jüngste Kind circa eine Woche zur Schule ging, stand ich eines vormittags daheim in der Küche und hatte ein ganz seltsames Gefühl. Ich habe nicht gewusst, was das ist, also habe ich versucht herauszufinden, was ich vergessen habe oder was los ist. Aber ich hatte nichts vergessen. Das Haus war leer und alles fertig. Nach einer Stunde etwa bin ich darauf gekommen, was das war: Langeweile.“
Danke für diese schöne, kleine Anekdote! 🙂 Jetzt sehnen wir uns nach Zeit für uns. Wenn wir sie dann irgendwann haben, denken wir sicherlich (auch) wehmütig an die turbulenten Jahre, die noch Gegenwart sind, zurück. Vor Langeweile habe ich allerdings keine Angst. Male mir jetzt schon in epischer Breite aus, wie ich jene ruhigen Stunden in der Zukunft verbringen werde. 😉